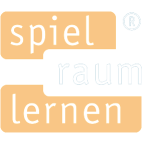Fortbildungen, Fachtage und Vorträge für OGS-Mitarbeiter/innen
Bei der Betreuung der Hausaufgaben ergeben sich viele Fragen:
Warum fällt es einigen Kindern so schwer, sich zu konzentrieren und aufmerksam bei einer Sache zu bleiben?
- Woran erkenne ich, dass Kinder überfordert sind?
- Wo sind die Grenzen und Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung im OGS?
Neben der Beantwortung dieser Fragen werden Übungen zur Lese- und Rechtschreibkompetenz, zum Erlernen grammatikalischer Strukturen,
notwendige Bausteine zum Erwerb der Rechenkompetenz
sowie Materialien und Übungen bei Teilleistungsschwächen, vorgestellt.
Der sichere Umgang mit Mengen und Zahlen bildet eine entscheidende Grundlage, um sich in alltäglichen Situationen orientieren zu können. Allein der Umgang mit unserem Kalendersystem, die Uhrzeiten und der Umgang mit Geld setzen die Fähigkeit voraus, sicher mit Zahlen und Größen hantieren zu können.
Kinder, die im mathematischen Bereich Schwierigkeiten haben, machen die Erfahrung, dass Üben und nochmals Üben wenig erfolgreich ist. Was also kann man tun, um diese Kinder zu unterstützen und zu fördern?
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit folgenden Fragen:
- Was sind die typischen Stolpersteine beim Rechnen, die von Kindern bewältigt werden müssen?
- Welche Symptome geben Hinweise auf eine vorliegende Rechenschwäche?
- Wann ist eine lerntherapeutische Hilfestellung notwendig und wie kann ich die Eltern dahingehend beraten?
- Welche Möglichkeiten habe ich in der OGS, um ein Kind mit Schwierigkeiten in diesem Bereich zu unterstützen?
- Wie zeigen sich die Folgen einer unbehandelten Rechenschwäche im Lebensalltag eines Kindes oder Heranwachsenden?
Was tun, wenn ein Kind immer wieder Buchstaben spiegelt, beim Lesen „aus der Reihe tanzt“ und scheinbar keine Maßnahme ihm helfen kann? Dieser Workshop versetzt die Mitarbeiter/innen im OGS in die Lage, Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche besser zu verstehen und sie begleiten und unterstützen zu können. Verschiedene Ansätze und praktische Übungen für den Lernalltag stehen daher bei diesem Vortrag im Vordergrund.
Dieser Workshop beschäftigt sich mit folgenden Fragen:
- Was sind die typischen Stolperstein beim Erlernen des Lesens und des Schreibens?
- Welche Symptome geben Hinweise auf eine vorliegende Lese – Rechtschreibschwäche oder gar Lese – Rechtschreibstörung ?
- Was ist der Unterschied und wann ist eine lerntherapeutische Hilfestellung unumgänglich?
- Welche Möglichkeiten habe ich im OGS, um ein Kind mit Schwierigkeiten in diesem Bereich zu unterstützen?
Wie zeigen sich die Folgen einer unbehandelten LRS im Lebensalltag eines Kindes oder Heranwachsenden?
Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unserer Kinder. Sie beeinflusst in hohem Maße das Selbstwertgefühl. Eine „gute“ Kommunikation stärkt das Selbstwertgefühl.
- Was aber macht eine gelungene Kommunikation aus?
- Wie lerne ich den anderen besser zu verstehen
(und angemessen zu reagieren)?
Der Alltag mit Kindern ist geprägt von vielfältigen Kommunikationssituationen. Nicht immer allerdings verlaufen diese so, wie wir es uns wünschen.
Wir alle kennen Situationen wie diese: Sie haben sich z.B. bewusst vorgenommen, mit einem Kind „ganz sachlich“ über etwas Bestimmtes zu sprechen. Trotzdem bleibt das Gespräch am Ende unzufrieden stellend.
Was ist passiert? Von welchen Faktoren ist bzw. war diese Situation entscheidend beeinflusst?
An zwei Vormittagen wollen wir uns intensiv mit Kommunikationsprozessen auseinandersetzen, um diese zu optimieren.
Gute Motivation und die Übernahme von (Eigen-)Verantwortung sind entscheidende Fähigkeiten für das Lernen. Allerdings kennen viele Mitarbeiter im OGS diesen – mitunter aufreibenden – Kampf: „Du musst aber doch …“ … „Warum fängst du denn nicht endlich an?“ … „Das ist aber doch deine Aufgabe …“
Tatsache ist: Schüler die sich selbst motivieren können, lernen deutlich leichter! Und die Kunst, sich selbst zu motivieren garantiert uns einen lebenslangen Lernzuwachs. Die Begriffe „Motivation“ und „Verantwortung“ spielen also in diesen Zusammenhang eine zentrale Rolle!
Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrages:
• Was bedeutet Motivation und Verantwortung konkret im Alltag?
• Wie kann ich die Selbstmotivation eines Kindes fördern?
• Welche persönlichen Kompetenzen sind dafür erforderlich?
• Wie können wir die Kinder unterstützen, diese Kompetenzen
zu stärken bzw. sie zu entwickeln?
Der Umgang mit ADHS Kindern stellt viele Erwachsene immer wieder vor große Herausforderungen. Mit ihrer motorischen Unruhe, Unkonzentriertheit und Impulsivität fordern sie eine hohe Aufmerksamkeit. Für alle Beteiligten heißt dies:
Aufmerksam – Differenziert – Hinschauen – und Spüren
Jungen sind von dieser Problematik häufiger betroffen, aber für alle Kinder gilt dennoch: ADHS ist nicht gleich ADHS.
An diesem Vormittag wird es geht es zum einen darum, in welchen konkreten Bereichen zeigen sich bei einem Kind
Auffälligkeiten Defizite Hindernisse aber auch Stärken
Wie können wir diese Kinder optimal unterstützen und begleiten?
Eine differenzierte Wahrnehmung und der Austausch wird somit im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen.
Der Umgang mit ADHS Kindern stellt viele Erwachsene immer wieder vor große Herausforderungen. Mit ihrer motorischen Unruhe, Unkonzentriertheit und Impulsivität fordern sie eine hohe Aufmerksamkeit. Für alle Beteiligten heißt dies:
Aufmerksam – Differenziert – Hinschauen – und Spüren
Jungen sind von dieser Problematik häufiger betroffen, aber für alle Kinder gilt dennoch: ADHS ist nicht gleich ADHS.
An diesem Vormittag wird es geht es zum einen darum, in welchen konkreten Bereichen zeigen sich bei einem Kind
Auffälligkeiten Defizite Hindernisse aber auch Stärken
Wie können wir diese Kinder optimal unterstützen und begleiten?
Eine differenzierte Wahrnehmung und der Austausch wird somit im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen.
Sprache dient der Kommunikation, allerdings sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Immer wieder eskalieren Situationen unter Kindern und manche setzen in Auseinandersetzungen Schimpfwörter, Sexistische Ausdrücke und Aussprüche ein, mit denen sie den anderen zielsicher provozieren, beschimpfen, beleidigen oder erniedrigen. Nicht immer ist ihnen dabei die Bedeutung der benutzten Begriffen bewusst, aber eines ist sicher, sie treffen damit ins Schwarze und verletzen. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Manche setzen sich mit den gleichen Mitteln zur Wehr, andere ziehen sich betroffen zurück oder bekommen Angst.
Wie aber reagiert man als Erwachsene in solchen Situationen mit Kindern.
Der Einsatz von Spielen im Lernalltag mit Kindern ist hilfreich zur Erhöhung der Motivation. Schließlich ziehen alle Kinder das Spielen dem Lernen vor! Welche Möglichkeiten gibt es also, Kinder mit Hilfe von Spielen beim Erlernen der Grundfähigkeiten Schreiben, Lesen und Rechnen zu unterstützten? Worauf sollte man als begleitende Person achten und wo hat ein spielerisches Fördern seine Grenzen?
In dem Workshop erfahren Sie mehr über den gezielten Einsatz von Lernspielen und wie Sie so manche Lernsituation mit Ihrem Kind entspannen können! Zudem bekommen Sie Anregungen, was Sie tun können, wenn der Einsatz eines Lernspiels nicht geeignet ist.
Freuen Sie sich also auf einen Workshop voller Spiele und Spielideen, die Sie leicht in Ihrer Arbeit mit Kindern umsetzen können!
Konflikte und Streitigkeiten sind Teil des Alltags und für die kindliche Entwicklung ausgesprochen wichtig. Nur so lernen Kinder, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, sich abzugrenzen und eine angemessene Streitkultur zu entwickeln.
Aber es gibt auch immer wiederkehrende Konflikte und Streitigkeiten, die Ausdruck einer tiefer liegenden Problematik sind. Die Kunst ist es, zwischen diesen beiden Hintergründen zu unterscheiden und zu wissen:
- Wann muss ich wie eingreifen?
- Wie kann ich zur Klärung eines Konfliktes oder Streites beitragen?
- Wie kann ich Kinder unterstützen, eine angemessene Streitkultur zu entwickeln?
Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre Konflikte und Streitigkeiten möglichst eigenverantwortlich und vor allem verantwortungsbewusst zu lösen.
In der Inklusionsassistenz kommen wir bei der individuellen Betreuung von Kindern oft an diesen Punkt: Das Kind schaltet ab, macht nicht mehr mit, steigt aus. Warum steigt das Kind aus? Bei der Beantwortung dieser Frage hören wir oft auf unser Bauchgefühl und unsere Erfahrung. Aber gerade wenn Behinderungs- und Krankheitsbilder dazu kommen, ist die Frage nicht leicht zu beantworten. Vielleicht hat das Kind keine Lust mehr und ist unmotiviert. Vielleicht ist die Aufgabe für das Kind aber auch praktisch nicht zu bewältigen.
Wie kann ich unterscheiden, ob das mir anvertraute Kind unmotiviert oder überfordert ist? Wie können wir die Signale richtig deuten und das Kind bestmöglich fördern und motivieren? In dieser Fortbildung beschäftigen wir uns mit den Themen Überforderung und Unterforderung, Lernstand und Kompetenzen. Wir gehen auch der Frage nach, wie wir in Zusammenarbeit mit LehrerInnen überfordernde Aufgaben an unser Kind anpassen können.
Inhalte:
- Kennzeichen von überforderten Kindern
- Umgang mit Kindern, die Grenzen austesten
- Angemessene Forderung und Förderung für bestmögliche Motivation
Zielgruppe: InklusionsassistentInnen (bzw. InklusionshelferInnen/-begleiterInnen)
- Definitionen von Empathie
- Möglichkeiten zur Einschätzung von Empathie
- Techniken zur Empathieförderung bei Kindern